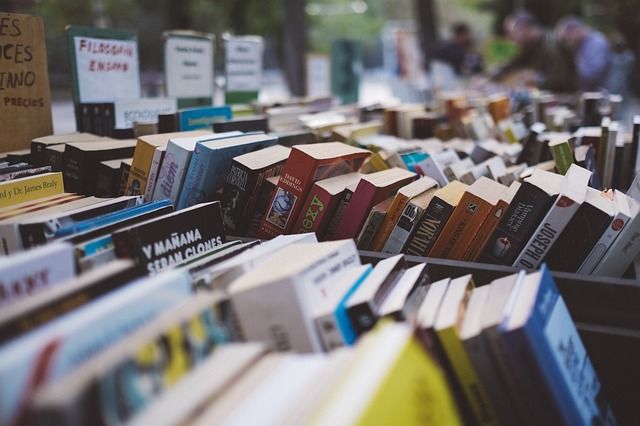Bücherbriefe

SCHWERPUNKT ODESSA
Maxim Biller
Mama Odessa
Kiepenheuer & Witsch, 233 Seiten, 24 €
Odessa Transfer. Nachrichten vom Schwarzen Meer
hrsg. von Katharina Raabe und Monika Sznajderman, mit einem Fotoessay von Andrzej Kramarz
Suhrkamp Verlag, 259 Seiten, 26,80 €
Isaak Babel
Mein Taubenschlag
übersetzt von Peter Urban, Hanser Verlag, 864 Seiten, 45 €
Jüdische Autoren und ihre Mütter – zerrissene, zärtliche, nervöse, narzisstisch unzuverlässige Söhne und virtuos nervende, unglaublich meinungsstarke und rätselhaft liebevolle Mütter - Gegenüber, die sich niemals ganz verstehen, niemals voneinander lassen können. Katharina, die Große, wollte der Namensnennung „Odysseus“ nicht zustimmen, sondern setzt „Odyssa“, europäisch dann Odessa, durch. Mit der grammatischen Weiblichkeit zog eine unvorstellbare Anziehungskraft in die Stadt ein, der sich bis heute niemand entziehen kann, Putin und seine Lakaien in ihrer unmenschlich geistigen Verblendung ausgenommen. „Mama Odessa“ sagen, schwärmen, flüstern, loben und preisen die Menschen ihre elegante Stadt voller Liebe und Verehrung. So klingt es durch die Erzählungen und aus den Bildern, mit denen in der Hand man sich Odessa nähern kann:
Die Beiträge von Katharina Raabe, Andrzej Stasiuk, Sibylle Lewitscharoff, Katrin Lange-Müller, Karl-Markus Gauß, Serhij Zhadan, Katia Petrowskaja, Emine Sevgi Özdamar und vielen anderen rufen eine Sehnsucht wach, die Maxim Billers „Mama“ schon immer in sich trug. Ob es das Schmuggler- und Ganovenviertel Moldavanka war, jene Treppe, auf der der Kinderwagen Eisensteins hinunterrollte im „Panzerkreuzer Potemkin“, ob es das Denkmal für den hierhin verbannten Puschkin war mit dem Rücken zur Stadtverwaltung, ob es das sagenhaft elegante Hotel Londonskaja war – überall hat Biller hingeschaut und Odessas Luft eingeatmet. Es ist eine Traumstadt, und so lachten die Polizisten über mich, als ich das babel-literarische Gaunerviertel Moldavanka mit seiner richtigen Polizeistation besichtigen wollte ...
Billers Roman hat mehr Themen als Odessa, doch Odessa ist vom ersten Atemzug des Buches im Spiel. „Im Mai 1987 – ich war erst sechsundzwanzig Jahre alt – schrieb mir meine Mutter auf einer alten russischen Schreibmaschine einen Brief, den sie nie abschickte.“ Ein erster Satz, der den Roman die kommmenden 230 Seiten mit allem an Ahnungen, Überraschungen, Verläufen, Dramatik, Schönheit und Schmerz versorgt. Die Mutter bereut, damals nicht zu ihrem sterbenden Vater in Odessa zurückgefahren zu sein, sie schreibt unerwartet sanft und liebevoll, wobei sie doch so sarkastisch und bitter sein kann. Mit diesen Erfahrungen beginnt der Sohn das Leben seiner Eltern und, damit dicht verwoben, das eigene zu erkunden, zu verstehen und das Talent zum Unglücklichsein als Lebensmelodie zu erkennen. Das konkrete Unglück begann 1941 mit einem Massaker der Nazis an 25000 Juden in Odessa, das der Großvater überlebte. Nach dem Krieg errichtete die herrschende Sowjetmacht einen Gedenkstein, erwähnte die Juden aber nicht. Diese antijüdische Gedenkpraxis der Sowjets gehört zum übelsten Erbe Stalins. Wer unter den Juden dagegen protestierte, riskierte Leben und Freiheit. Bei einem Ausflug der Familie mit einem Auto wären sie fast umgekommen, weil ein KGB-Agent Nervengas aufs Lenkrad gepinselt hatte – eine von Biller äußerst dramatisch erzählte Fahrt mit Folgen für Vater, Mutter und Sohn. Die drei finden sich nach der Flucht aus Odessa in Hamburg wieder, nicht in Israel, wohin der zionistisch erfüllte Vater eigentlich wollte. Nun beginnt eine so windungsreiche, ineinander stürzende, nicht durchgehend durchschaubare, wild bewegte, aber anhaltend verstehensbereite, ja, freundliche Familiengeschichte, dass man immer wieder von den zärtlichen und einfühlsamen Tönen überrascht wird. Der Mutter gibt Biller die größte Ehre, indem er sie selbst über weite Strecken erzählen lässt, die Schriftstellerin Rada Biller. Hat der Sohn denn nicht von ihr das ungestüme und drauflos stürmende Erzählen gelernt? Wir lernen das jüdische Hamburg im Grindelviertel kennen, diesen und jenen Erzschlawiner, eine marodierende Ehe, eine „Nazihure“, Mutter-Sohn-Briefe, grausige Komik und hypochondrische An- und Ausfälle. Die Dreiecksgeschichte „Mutter/Sohn/Odessa“ nimmt einen in ihrer zärtlichen Wucht reichlich mit und verliert nie den Ton der verwundeten Liebesklage. Keiner der biblischen Klagepsalmen endet mit dem Klagen; das ahnt oder weiß Maxim Biller. Deshalb lautet auch der letzte Satz des Buch mit einem Zitat seines Großvaters: „Lass dich nie von deinem langen, schweren Weg abbringen, den du selbst noch nicht kennst.“ Die Kette der Generation darf nicht reißen. Maxim Biller wird dem folgen. Und er wird weiter schreiben, vom Schreiben und vom Leben. Helmut Ruppel

WOLF HAAS. EIGENTUM
Hanser Verlag
Ja, ein Wiener, und wieder bringt er Österreichs Beitrag zur Weltliteratur verhalten, knurzig, mit einer Masse Schmäh unter einer Wagenladung voll Grummeleien so elegant und von verblüffender Anmut „zur Sprache“ wie kaum einer: den Tod. „Es lebe der Zentralfriedhof!“, „Der Tod, das muss ein Wiener sein.“ Franz Schuh, der große Theatergeist, nannte seine Lebenserinnerungen „Lachen und Sterben“ und die entscheidende Wiener Tugend „Einsamkeitsfähigkeit“. Der älteste Vorfahr von Georg Kreisler ist der Autor von „Ach, du lieber Augustin, alles ist hin ...“ , das Tanzgeträller rund ums Pestgrab, Österreichs unverkennbar moribunder Eigenton, auch ihn beherrscht Haas sprachlich meisterhaft. Selbst in der Körper-Sprache kann er es: Das SZ-Magazin vom 20.10.2023 zeigt Wolf Haas in 7 Szenen der Reihe „Sagen Sie jetzt nichts“ - ein lustig-kümmerliches Mauerblümchen, das da einen Wiener Autor ab-bildet. Früher war er Werbetexter: „Lichtfahrer sind sichtbarer“ und „Ö 1 gehört gehört“. Dann kamen die einmaligen unvergesslichen Brenner-Krimis mit Brenners Tresen-Stummel-Monologen und die wirklich seltsamen Romane. „Das Wetter vor 15 Jahren“, wohl der Beste!
Nun die Überraschung: „Drei Tage vor ihrem Tod, sie war fast 95 Jahre alt und nicht mehr ganz da, erkundigte sich meine Mutter bei mir nach ihren Eltern ...“ Ein Satz, den jedes gescheite Literaturseminar ein Wochenende herausfordert; mit ihm beginnt Wolf Haas die Geschichte vom Tod seiner Mutter zu erzählen. Die Frage ärgert ihn; immer wollte seine Mutter ihm weismachen, es ginge ihr sehr schlecht und drei Tage vor ihrem Tod die Neuigkeit, es geht ihr sehr gut! Wir erwähnten ja, Wien und der Tod … Er erfindet ein Telefonat mit dem Himmel und kann der Mutter mitteilen, allen ginge es gut bis auf den Vater, der habe einen Schnupfen, sei aber auf dem „Weg der Besserung“. Damit löst er eine intensive Erinnerungswelle über die Erkältungsanfälligkeiten des Vaters aus und wir sind nach wenigen Seiten im äußerst harten Leben der Mutter: „Den ganzen Tag lang nur Arbeit, Arbeit, Arbeit.“ Und er setzt ihrem engen, bedürftigen Leben ein Denkmal. „Deine Mutter war ein schwieriger Mensch. Sie hat fast jeden im Dorf einmal beleidigt“. Haas hilft sich mit sprachlichen Möglichkeiten Aussichtslosigkeit, Störrischkeit, Hoffnungslosigkeit Ausdruck zu verleihen, z.B.der Wiederholung. So erleben wir das Alltagsleben der Mutter in einer Endlosschleife. Sie schuftet, schuftet, schuftet. Am Ende bekommt sie auf dem Friedhof 1,7 Quadratmeter, ganz allein ihr Eigentum. „Ich war nicht traurig, dass sie gestorben war. Im Gegenteil, ich konnte zum ersten Mal in meinem Leben glauben, dass es ihr gut ging.“ Da liegen nun schon Vater und Bruder, so sagt Haas „unser Grab“. Das alles ist wirklich nur traurig in Maßen, dazwischen gibt es Meditationen über den Friedhof, den einzigen Ort im Dorf, wo das Leben sich richtig abspielte, (man muss aufpassen, nicht in diesen österreichischen Todessog zu geraten!), dazwischen gibt es wunderbare Exkurse über die Wirkung zu Tränen rührender Musik. Sprachlich und emotional in höchstem Maße überzeugend sind die Erzählkapitel der Mutter, ihr Dialekt aus dem Pinzgau. Es ist kaum möglich, diesem stilistisch exzellenten und sehr persönlichen Roman, der nicht traurig ist, gegenüber Distanz zu halten, vor allem dann, wenn Haas nebenbei uns versichert: „Nie steht man fester auf der Erde, als wenn man am Grab steht.“ „Ach, du lieber Augustin ...“ Ist der Sohn nun von all dem berührt, bewegt, beansprucht? „Vielleicht glaubt mein Unterbewusstsein ja doch, dass ich dort, wo meine Mutter jetzt ist, ich weiß nicht genau, wie es da heißt, einmal anrufen und sagen könnte, dass es mir gut geht.“ Danke, Wolf Haas, für diesen, wörtlich, außer-ordentlichen Roman! Helmut Ruppel
159 Seiten
22 €

UWE TIMM. ALLE MEINE GEISTER
Kiepenheuer & Witsch Verlag
Und es gelingt ihm, nicht einmal kalauernd Kürschners Literaturkalender zu erwähnen, so ernsthaft-freundlich erinnert er an die Jahre 1955 – 1961, die prägenden Jahre seines Lebens als Kürschner-Lehrling und Leser der Werke Benns, Dostojewskis, Camus', Kafkas, Salingers, Thomas Manns, William Faulkners, Henry Millers (oijoijoi, aber St. Pauli war nicht seine Meile ...). Nun ist Uwe Timm 19 Tage älter als der Autor dieses Briefes – es liegt nahe, hinzuhören, wie er die Jugendjahre erinnert. Ich hatte keine Rechtschreibschwäche, aber auch keine Kürschnerlehre (blätterte schon früh im Kürschner), las diese Bücher wie er. Aber Timm erzählt so freundschaftlich, fast geschwisterlich, so im sympathischen Einklang mit dem fünfzehn- und siebzehnjährigen, dass einem aufgeht: Es muss zwischen dem unvermeidlichen Narzissmus und dem sich aufdrängenden ironischen Zynismus im Blick auf diese Jahre noch einen Spalt geben für gelassenes Einvernehmen. Timm könnte mit diesem Kürschnerlehrling eine herzliche Freundschaft schließen, unbekümmert und von neugieriger Sympathie getragen, keine Kameraderie, aber ruhiger Austausch und Anteilnahme. Altmodisch gesprochen: Es ist ein reifes und ruhiges Buch und tut so gut zu lesen, auch für jeden Jahrgang nach 1940! Die komplexen Nöte der westdeutschen Republik, das vage Wahrnehmen von etwas, das DDR heißt, die Blüte der Pelzmode und ihr Verdämmern, zwei schwedische Mädchen aus Lund, „mit weißen Schirmmützen und sehr blond“ - Momentaufnahmen, Partikel, Gedächtnisblitze - das Buch ist keine Biographie, eher ein Blättern in Tagebüchern, Briefen, Alben, Erinnerungen und Stimmungen. Verstöße gegen andere Menschen? Nein, nur Zorn gegen die universelle Verheerung in Humanität und Kultur durch die Nazis, die als gute Deutsche weiterlebten. Das Schöne an diesem Buch ist die anhaltende Vertrautheit mit der eigenen Lebensgeschichte, Uwe Timm hat nach über 80 Jahren Uwe Timm zum Freund, samt allem, was Freundschaft einschließt - und aushält. Das Buch – ein Geschenk für alle, die schon beginnen, darüber nachzudenken, wie alles anfing, wohin es ging, heute steht oder geht. Und nicht redselig. Danke! Das alles mit dem Nebengewinn, viel zu lernen über das dahingegangene Kürschnerhandwerk. Helmut Ruppel
282 Seiten
25 €

NAVID KERMANI. DAS ALPHABET BIS S
Hanser Verlag
Er hat das Alphabet für viele Texte in Bewegung gebracht. „Ungläubiges Staunen - Über das Christentum“ (2015) steht greifbar, hausapothekengleich, im Regal. Daneben „Ausnahmezustand - Reisen in eine beunruhigte Welt“ (2013). Pflichtlektüre für die Gegenwart: „Es ist nicht lange her, da galten die Palästinenser als die weltoffenste und demokratischste Gesellschaft unter den Arabern, mit dem höchsten Anteil von Frauen in den Führungspositionen. Jetzt breitet sich unter ihnen ein religiöser Dogmatismus aus, wie ich ihn in diesem Ausmaß nicht einmal aus Iran kenne ...
Und das Riesengefängnis Gaza, einer der wohl trostlosesten Flecken der Erde, haben die Islamisten bereits übernommen … Ich kann mich nicht erinnern, jemals aus einem Land so deprimiert zurückgekommen zu sein. War es ein Land? Palästina war es nicht.“ Das war im April 2005 ...
Kermani ist der literarisch-politische Seismograph des Landes, sein Band „Morgen ist da. Reden“ (2010) wirkt wie ein Licht in der Nacht. Kühn, tolerant und durch nichts zu ersetzen: „Jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt näher kommen“ (2022). Mögen manche redselig sein, für ihn müsste man das Wort „schreibselig“ einführen. Sein neues Buch beginnt: „Das Grab der Mutter besucht, das die Gärtnerei hergerichtet hat, tröstlich: ein Rechteck dunkelbrauner, wie Torf lockerer, sorgsam begradigter Erde, groß genug auch für den Vater, mich und weitere Nachfahren. Mein Sohn hat bereits angekündigt, er möchte ebenfalls bei der Familie liegen, wenn es soweit ist ...“
Der Bücherherbst hat es mit Abschieden und Friedhöfen zu tun, eine wohl kaum beabsichtigte Spiegelung zur unmittelbaren Gegenwart? Diesmal ist es eine Tochter, die von der Mutter Abschied nimmt. Zuvor hatte ihr Mann sie per Scheidung verlassen, der Sohn einen Herzinfarkt erlitten, der Vater, schwer lenkbar, im Krankenhaus - Verluste, Trennungen, Abbrüche, schmerzvolle Emotionen, viel Zorn und wenig Vergebung. Kermani als Erzählerin ist „mit einem Satz“, sprunghaft gemeint, allzeit mittendrin.
Die Erzählerin (!) kommt aus dem Iran, ist Schriftstellerin, Orientalistin, das gilt alles auch für Navid Kermani; die taz widmet dieser Konstellation eine umfangreiche Rezension. Auch wir fragen: Erschafft der Erzähler, biblisch gesehen, sein „Ebenbild“? Sie agiert rhetorisch kaum mit feministischen Klischees à la „Alle Männer sind eitel“, ist offenkundig keine identitätspolitische Agitatorin. Eher will sie dem immer schon geübten universellen Rederecht der Männer, der Ungleichverteilung in der Dominanz des Erfahrens, Erklärens und Deutens eins auswischen. Die Allzuständigkeit männlicher Redeführung ist Kermani vielleicht selbst aufgefallen? Ein Tage-Buch beginnt mit – logisch – 365 Texten, Meisterwerke der kleinen Form, therapeutische Kurzessays, Buchanalysen bis hin zum Aphorismus, Lichtblicke verhaltener Dankbarkeit für das Leben, Kurzkommentare, Glossen, Miszellen. Die vom Erzähler Kermani geschaffene Erzählerin nennt sich „Leseschreiberin“. Das kam so: Am Ende des Trauermonats will sie die Bücher lesen, die ungelesen alphabetisch in den Regalen stehen, nein „modern“, ein intellektueller Doppelklang. Sie liest dem Alphabet nach und beginnt (und hält viele allzeit in der Nähe) mit Peter Altenberg, wobei wir wieder im Haas'schen Wien wären. Besondere Aufmerksamkeit erhalten Emil Cioran, Emily Dickinson, Julien Green, Ernst Jünger (mit deutlichem Entsetzen), Hermann Hesse, Jose Lezama Lima, Peter Nadas, Paul Nizon, Ovid – bei „S“ muss der Text abbrechen. Der Bewusstseinsstrom wird für den nie banalen Alltag erweitert, Radarkontrollen, das Jüngste Gericht, Jogger und Hunde, eine Meditation über den Hass, „Nach Gott gesehnt“, die Statue von Fernando Pessoa vor seinem Lieblingscafé, zähe Kümmernisse seit der Scheidung. Die Bestimmung des Ganzen als „Roman“ ist provokant, ein reizvolles Rätsel. Was an Romanhaften steckt hinter dem Abarbeiten der eigenen Bibliothek? Der Wunsch bei manchen Büchern, sie auch gern selbst geschrieben zu haben? Arbeit an der exogenen Depression, kurz: Lesen und genesen? Manche professionellen Rezensenten bescheinigen Kermani ein „genresprengendes Talent“. Davon haben die Lesenden großen Gewinn, denn das „Alphabet bis S“ singt das Hohe Lied des Lesens an der Festigung der inneren, der persönlichen Lebensstruktur. Sein „ungläubiges Staunen“ geht über die Weihnachtsfrömmigkeit hinaus: Wieder bittet er, einen Schritt näher zu kommen, von dort, wo wir stehen. Der Schritt fällt leicht. Helmut Ruppel
591 Seiten
32 €

RICHARD FORD. VALENTINSTAG
Hanser Verlag
übersetzt von Frank Heibert
In den USA hat das Glück Verfassungsrang: „pursuit of happiness“ gehört zu den unveräußerlichen Rechten des Menschen! Ach, sorry, Leben und Freiheit auch. Auf der Seite des „happiness“ hat Frank Bascombe, Fords Romanfreund seit vier Büchern, bisher nicht gelebt. Aber er kämpft sich weiter durch, im Buch ist er 74 geworden und blickt auf sein „beifallsloses“ Leben zurück und auf die Lage des Landes, und das in einem kunstvoll-flapsigen, bartresengefärbt-raunzigen Ton. Man hört rasch seine Passionsgeschichte: Überstandener Prostatakrebs, Loch im Herzen, kleiner Schlaganfall, zwei gescheiterte Ehen, ein früh verstorbener und ein unheilbarer Sohn, ALS heißt das Elend: „Amyotrophe Lateralsklerose.“ Vater und Sohn unternehmen eine letzte gemeinsame Reise. Sie geht zum „Maispalast“,einer „kremlartigen Hommage an Demeter“. Sie landen in einem Casino, einer Mischform von Mittelstandsvorhölle und Konsumentenparadies. Der Vater liest „Laber Rhabarber“ (Heidegger), der Sohn nennt ihn, der Lawrence heißt, Florence, um ihn mit der Nightingale boshaft-zärtlich zu sticheln. So fahren sie dahin in einer Klapperkiste von Wohnwagen, der „Warmer Wind“ heißt, in dem es so eiskalt ist, dass man nicht darin schlafen kann. „Pursuit of happiness“? „Wir tun, was Amerikaner zu tun pflegen – wir führen ein Gespräch, das kein echtes Gespräch ist, aber eine Art Verbindung schafft.“ Das Land ist ihm fremd geworden, toxische Begegnungen, Immobilienkrisen, Hurrikane, Finanzkrise, schließlich Trump. Das alles ist nicht traurig, es ist bewegend, ja, ein unvergessliches Leseerlebnis, Anteilnahme steigt im Leser auf. Nun sehen sich Richard Ford und Clint Eastwood nur ein wenig ähnlich, aber in der Entschlossenheit, nicht aufzugeben, sind sie sich sehr ähnlich. Irgendwo sagt der todkranke Sohn zu seinem Vater: „Ein tolles Leben hab ich nicht hingelegt, oder?“ „Nein. Aber du hast dich ordentlich geschlagen.“ Mehr will Frank Bascombe auch nicht in diesem Buch von Richard Ford, das man sehr berührt aus der Hand legt, weil es viel zu früh zu Ende ist. Helmut Ruppel
383 Seiten
28 €

HILARY MANTEL. SPRECHEN LERNEN
Dumont Verlag
übersetzt von Werner Löcher-Lawrence
Nils Minkmar schrieb jüngst in seinem klugen und schönen Blog „Der siebte Tag“, er habe so lachen können wie lange nicht mehr beim Lesen in Hilary Mantels Geschichten. Die große geadelte, mit Preisen „gekrönte“ und als Kennerin des 16. Jahrhunderts in England hochverehrte Cromwell-Biographin können wir kennenlernen als Erzählerin kämpferisch-spritziger Geschichten. Charmant und rabiat schlägt sie sich durch ihren harten sozialen Alltag. Die weithin respektierte Historikerin mit ihren brillanten Romanen erleben wir hier als junge Frau „Learning to talk“, und das auf eine unverblümte, streitlustige, nichts hinnehmende und geschliffen austeilende Disputantin, scharfsinnig, selbständig, gewitzt und angriffslustig. In ihrer Lebensgeschichte „Von Geist und Geistern“ (2003) hören wir ihrem lebenslangen Kampf wider die Widerstände zu, die ihr entgegen gebracht wurden. Törichte, misogyne Ärzte vermasselten ihre Jugend mit hanebüchenen Diagnosen; sie hatte sich mit allen Energien zu befreien von männlicher eklatanter Dummheit. Jurastudium und Sozialarbeiterinnen-Praxis halfen ihr auf, bis das Schreiben ihr ins Licht einer selbstbestimmten Arbeit heraushalf. Sie gewann die respektabelsten Buch-Preise. Ihre sieben Erzählungen zu lesen ist eine Wohltat, sie zu entdecken zugleich eine Öffnung zur großen Tradition britischer historischer Romane. In den vielen Nachworten zu ihrem Tode 2022 fiel auch das Wort „Genie“. Helmut Ruppel
160 Seiten
22 €

DRAGO JANČAR. ALS DIE WELT ENTSTAND
Paul Zsolnay Verlag
übersetzt von Erwin Köstler
Maribor – Marburg an der Drau, schon dies Namens-Paar lässt eine unruhige Geschichte vermuten. Der Autor ist 1948 in Maribor geboren, wird später in Lubljana leben, im Herzen dieses kleinen europäischen Landes Slowenien. Es war Gastland der Frankfurter Buchmesse 2023 und brachte eine ungewöhnlich große Zahl von Dichterinnen und Dichtern mit. Für die lesende Öffentlichkeit eine veritable Überraschung! Mit den Augen und Ohren Danijels, Jančars junger Hauptperson, lernen wir die wechselvolle slowenische Geschichte kennen. Slowenien lesend sich zu nähern mit der lebhaften Vielfalt eindrücklicher Charakter – ein schöner Gewinn! Helmut Ruppel
272 Seiten
26 €

RUTH KLÜGER. ANDERS LESEN. JUDEN UND FRAUEN IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN LITERATUR DES 19. UND 20. JAHRHUNDERTS
Wallstein Verlag
herausgegeben von Gesa Dane
In den versammelten Aufsätzen widmet sich die in Irvine/Kalifornien und Göttingen lehrende Auschwitzüberlebende (1931 - 2020) mit Intensität Heinrich Heine, Franz Kafka und Arthur Schnitzler, wünscht mehr Aufmerksamkeit für Marie von Ebner-Eschenbach als einer „Anwältin der Unterdrückten“ und schaut Ingeborg Bachmann über die Schulter in ihrem Umgang mit Wahrheit und Dichtung. Das Problem des literarischen Umgangs mit dem Massenmord beleuchtet sie mit einer Studie zur „Zeugensprache“ bei Wolfgang Koeppen und Alfred Andersch. Mit ihren Studien wird sie „weiter leben“, entsprechend dem Buchtitel, mit dem sie nach der Shoah in die literarische Welt trat. Helmut Ruppel
256 Seiten
26 €

SIMON SEBAG MONTEFIORE. DIE WELT. EINE FAMILIENGESCHICHTE DER MENSCHHEIT
Wallstein Verlag
herausgegeben von Gesa Dane
In den versammelten Aufsätzen widmet sich die in Irvine/Kalifornien und Göttingen lehrende Auschwitzüberlebende (1931 - 2020) mit Intensität Heinrich Heine, Franz Kafka und Arthur Schnitzler, wünscht mehr Aufmerksamkeit für Marie von Ebner-Eschenbach als einer „Anwältin der Unterdrückten“ und schaut Ingeborg Bachmann über die Schulter in ihrem Umgang mit Wahrheit und Dichtung. Das Problem des literarischen Umgangs mit dem Massenmord beleuchtet sie mit einer Studie zur „Zeugensprache“ bei Wolfgang Koeppen und Alfred Andersch. Mit ihren Studien wird sie „weiter leben“, entsprechend dem Buchtitel, mit dem sie nach der Shoah in die literarische Welt trat. Helmut Ruppel
256 Seiten
26 €

HELMUT BÖTTIGER. CZERNOWITZ. STADT DER ZEITENWENDEN
Berenberg Verlag
Kommen in den Ukraine-Fernsehberichten Bilder von Czernowitz und Odessa, muss man den Atem anhalten; sind doch mit den Städten so viele Namen, Titel, Zeilen und Lebenszeichen verbunden! Der Autor dieses Briefes hat auch „an der Hand“ von Peter Rychlo, dem Czernowitzer Literaturwissenschaftler, Straßen, Gässchen, Hinterhöfe, Gärten, Uni-Gebäude, den Friedhof, das Pruth-Ufer und die Jugendstil-Cafés besucht – benommen, sprachlos und mit unvergesslichen Bildern zurückgekehrt. Böttiger erzählt von seinen Reisen dies alles viel ausführlicher und weitgreifender über Czernowitz hinaus (Brody, Drohobytsch). Gegenüber Montefiores anderthalbtausend Seiten mächtigem Band, ist dies 88 Seiten schmächtige Buch ebenso liebenswert und wohltuend zu lesen, eben einmal die gesamte Welt en miniature!
Helmut Ruppel
88 Seiten

Tom Segev. Jerusalem Ecke Berlin. Erinnerungen
Aus dem Hebräischen von Ruth Achlama
Siedler Verlag, 416 Seiten, 32 €
Liegt der Titel im Buchladen auf dem Büchertisch „Israel Ecke Weltliteratur“, hat er umso mehr den angemessen sprechenden Platz gefunden, so unbewusst wie punktgenau...Und wenn er in „Blau-Weiß“ leuchtet, den Nationalfarben Israels, die aber rechts oben und links unten von den brennenden Weltgeschehnissen bedroht sind, ist die zu erwartende Herausforderung des Buches nicht mehr abzuweisen!
Tom Segev, prägend-pointierte journalistische Stimme des modernen Israel, ist seinem Buch in Deutschland nachgereist, ist in vielen Interviews, Lesungen und Seminaren gelassen engagiert präsent. In Berlin wurden er und sein Buch von Shelly Kupferberg präsentiert, die selbst eben ihren Urgroßonkel Isidor (wir kommen noch zu ihr und ihm...) vorgestellt hat. Viele Interviews sind lebhaft und rasch, oft mehr vom Interesse an Segev denn von Kenntnis seines Buches bestimmt, denn das Buch könnte ein gediegenes Geschichtsstudium ausfüllen – sieht man sich das Personenregister an, steht die Frage auf: Wer auf dieser Welt ist nicht erwähnt....Von Albert Speer bis Simon Wiesenthal, Hannah Arendt bis Baldur von Schirach - der Bogen umspannt mehr als die Ecke Jerusalem/ Berlin. Und ein „Eckensteher“ war Segev in seinem Leben keine Sekunde, viel eher einer mit Kanten und Ecken, wie er lebenslang in Ma'ariv und Ha'aretz, tonangebenden Zeitungen in Israel, zur Kenntnis gab. 1945 in Jerusalem geboren, nur wenig älter als sein Land, begleitet er diese jüngere Schwester aufmerksam, liebevoll, scharfäugig und weiser werdend von Tag zu Tag bis heute. Zum 75. Geburtstag Israels wird auch er viel jenen zu erzählen haben, die seine Bücher der historischen Begleitung noch nicht lesen konnten: „Es war einmal ein Palästina“ (2005), „Die ersten Israelis, Die Anfänge des jüdischen Staates“(2008) und die Biographien von Simon Wiesenthal (2010) und David Ben Gurion (2018), um nur diese zu nennen. Für seine Dissertation arbeitete er auch in der Nähe der Hammersteins und Weizsäckers, an der Grenze zu Dahlem auf dem Gelände zwischen Wasserkäfersteig und Täubchenstraße, in einer Bunkeranlage, die - in krassestem Kontrast zu den lieblichen Straßennamen – die fürchterlichsten „Dokumente“ der Nazi-Zeit enthielt, dem Berlin Document Center. Berlin selbst nennt er eine „Stadt ohne Frohsinn“, was nicht für andere Orte Deutschlands gilt, das er viel und intensiv bereist. Die Schilderung der Haftentlassung Speers und von Schirachs in Spandau ist ein Alptraum-Kapitel. Später besucht er Speer und es geht ihm durch den Kopf: „Da drücke ich eine Hand, die auch Hitler gedrückt hat.“ Andere Kapitel sind wohltuend, erheiternd, mit Weisheit, Witz und Herzensgüte geschrieben. Ob er nun Teddy Kollek porträtiert, den charismatischen Bürgermeister von Jerusalem, Mutter Teresa, Bärbel Bohley, Hannah Arendt oder Anwar Sadat – immer sind es Menschen mit Geschichten. Und hier schlägt auch das Herz des Buches: Segev ist überzeugt, „dass Deutschland inzwischen für Israel das wichtigste Land ist, gleich nach Amerika. Politisch, wirtschaftlich, militärisch, wissenschaftlich und kulturell gibt es für Israel kein wichtigeres Land...wie unnormal die Beziehungen zwischen Deutschland und Israel immer noch sind, das war interessant zu analysieren (= Gedenken an das Attentat in München. H.R.). Gleichzeitig gibt es aber trotzdem eine Wärme und eine Kooperation, die Israel – außer mit den USA – sonst mit keinem anderen Land hat.“ (Jüdische Allgemeine, 15.11. '22) Die Geschichte dieser beiden Länder und ihrer Menschen bewegen ihn und haben ihn zu diesem Buch bewegt. Tom Segevs erzählt von seinem Enkel Ben: „Eines Tages sagte er unvermittelt zu mir: 'Opa, weißt du, ich habe Worte furchtbar gern.'“ Da kann Segev nur noch antworten: „Ich auch“. Die beiden letzten Worte des Buches – gewiss nicht des Autors...Und es gilt ebenso für die Übersetzerin Ruth Achlama! Helmut Ruppel

Andrea Giovene. Die Autobiographie
Andrea Giovene, Die Autobiographie des Giuliano di Sansevero, Ein junger Herr aus Neapel, Roman,
Band 1, Aus dem Italienischen von Moshe Kahn, mit einem Nachwort von Ulrike Voswinkel
Galiani Verlag, 305 Seiten, 26 Euro
Andrea Giovene, Die Autobiographie des Giuliano di Sansevero, Die Jahre zwischen Gut und Böse, Roman, Band 2, Aus dem Italienischen von Moshe Kahn
Galiani Verlag, 336 Seiten, 26 Euro
Zugegeben, meine erste Sympathiebewegung galt Moshe Kahn, dem Übersetzer. Er hat Primo Levi, den unvergleichlich humanen Erzähler von Auschwitz, in die deutsche Sprache gebracht; wir können dank ihmPier Paolo Pasolini, Luigi Malerba, Andrea Camillieri und Norberto Bobbio in Deutsch wahrnehmen, nun auch den literarischen Schatz von Andrea Giovene genießen!
Den Töchtern Hammersteins gleich in Berlin verlässt in Neapel der junge Guiliano sein aristokratisches Elternhaus und „erfährt“ Länder, Menschen und Mentalitäten in Europa, mit Leichtigkeit und Eleganz auf vielfältig verwirrende Weise italienische amore und französischen esprit, beide aufs Allerdeutlichste in verführerischer Diskretion, aufs Erkennbarste verschwiegen, liebesschmerzlichst diszipliniert und auf das Charmanteste gut erzogen – in einem hellwachen, vornehmen, bezwingend schönen Deutsch, das die geschliffene Kunstprosa (so die Kenner) glänzend wiedergibt. Am Ende des nächsten Jahres werden fünf Bände dieser Lebensreise durch Europa zwischen 1903 und 1957 vorliegen; in den zwei nun erschienenen erlebt Guiliano in Neapel den anhebenden Faschismus mit Mussolini und kopfverdrehende Abenteuer in dem „schönen septembrischen Paris“, wozu auch sensible Exkursionen in die Welt von Rubens` Zyklus der Maria de Medici und das Werk Goyas im Prado gehören. Auf viele anmutige weibliche Wesen fällt sein Auge, „und er verhedderte sich in den Fängen seiner verdammten Komplexe“. An vielen aufregenden Orten hält er sich auf , zeichnen sie sich nun aus durch Opulenz oder durch Misere. Gerät er in Kreise von „entmutigender Zweitklassigkeit“, weiß er zu fliehen...Fluchtpunkt ist immer die Wärme der Heimat und der Schoß der Familie in Süditalien, wo die Familie sich seit dem 11. Jahrhundert durch die Zeiten bewegt. Dort in Neapel wird er in striktem Patriarchat „gebildet“, erzogen, geprägt, zur wachsenden Neugier auf ein ganz anderes Leben eingestellt, jenseits der Traditionen, Konventionen, Etikette und Weltsichten, allesamt in Stein gemeißelt und komplett vernachlässigt. Und er lernt, lebensbestimmend, ein junges Mädchen kennen: „...von ihr bewacht, würde ich nie mehr einsam sein, noch würde ich mich je wieder verlieren.“ Er verliert sie, er verlässt die Heimat, er versucht sich in einer neuen Existenz zwischen Einsamkeit und mondäner Gesellschaft, Abbrüchen und Aufbrechen in Mailand, Paris und Rom, heillosen Affären und dichterischen Höhenflügen – der alltägliche Faschismus sorgt für eine bedrohliche Gefährdung in allem Handeln.
Ulrike Voswinckel erzählt im kenntnisreichen Nachwort zum ersten Band die ganze Geschichte – uns bleibt nur, die Bände drei bis fünf sehnlichst zu erwarten. Vom Autor (1904-1995), brillant belesener Journalist und Privatgelehrter, soll hier nur so viel gesagt werden, dass er in vielem seinem Helden nahekommt. Er wird in den Medien oft mit Marcel Proust und Giovanni Tomasi di Lampedusa („Der Leopard“) zusammengebracht, was wohl Werbeüberredung ist. Anfangs wollte kein Verlag das Manuskript annehmen, es benötigte bizarre Umwege (999 Privatdrucke u.ä,) zur Öffentlichkeit.
Bizarre Wege, der Öffentlichkeit zu entgehen, ja, sie zu meiden, aus ihr zu entfliehen, wird jeder Mensch finden wollen, der ein Buch liest, von dem er nicht lassen kann. Er wird gerade in den festlichen Tagen Besuche vermeiden, zu keiner Einladung gehen, Verstecke ausfindig machen, familienfeindliches Verhalten vorgeworfen bekommen, auf Fest- und Freizeitdistanz gehen, weil er nicht anders kann, denn das Buch hat ihn magnetisch, hypnotisch in Bann gezogen; er und sie können es nicht beiseite legen, so überbordend furios ist seine Anziehungskraft. Helmut Ruppel
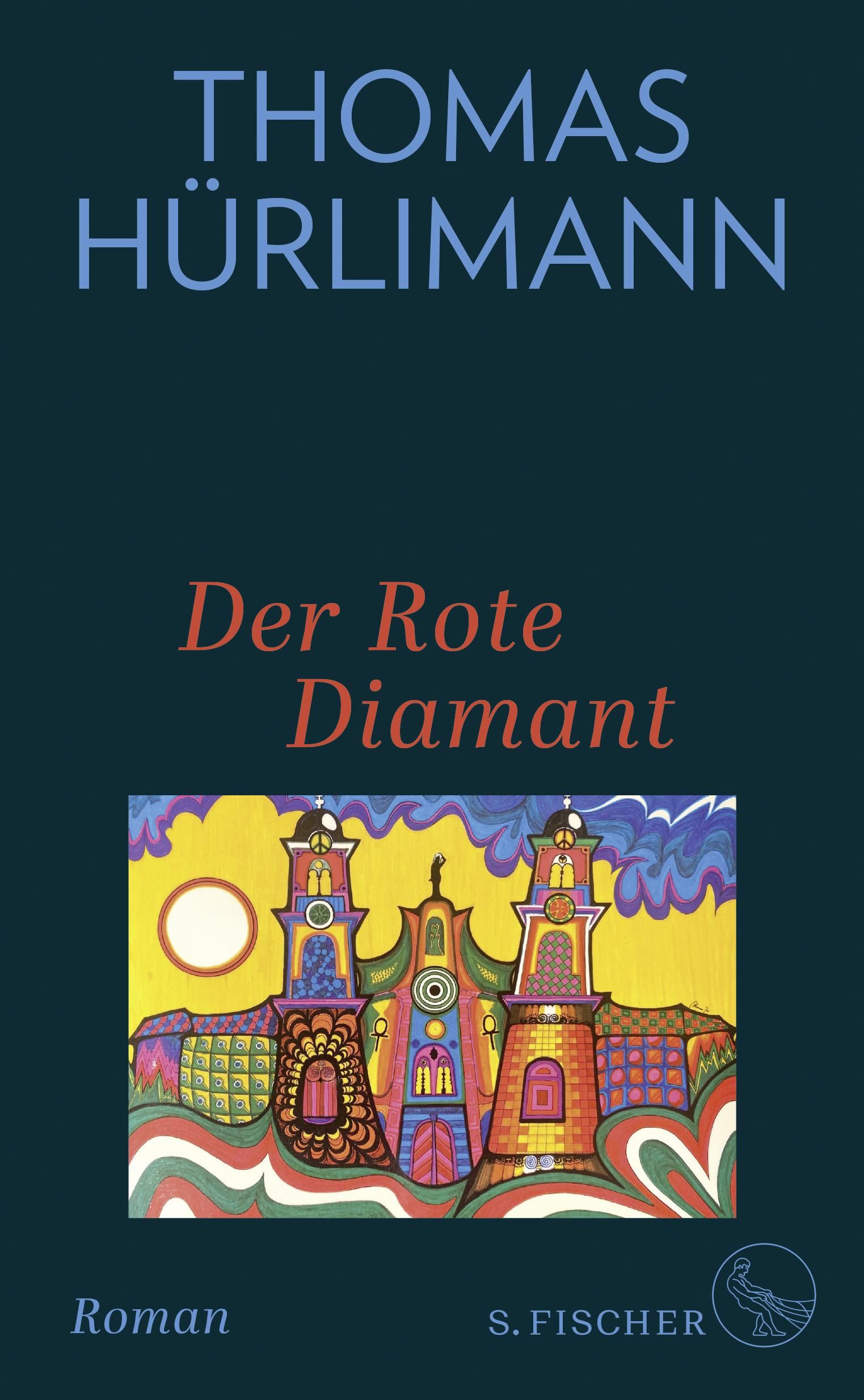
Thomas Hürlimann. Der Rote Diamant
S. Fischer Verlag
Es sind diese Benediktiner-Klöster, die die jungen Helden erziehen wollen, die die aufregenden Internatsromane hervorrufen“. „Das leuchtende Gegenstück auch der drückendsten Einsamkeit ist die Freiheit. Doch in gewissen Einrichtungen ist man nur einsam, ohne frei zu sein...“ seufzt Giuliano, das Kloster vor Augen, seufzt Arthur Goldau: „Das Kloster, in dessen Internat ich morgen Nachmittag als Zögling eintreten würde, lag in den Bergen und war der Himmelskönigin geweiht und hieß Maria zum Schnee“. Es sind diese Internate, die seit Musils Zögling Törleß und Hermann Hesses Hans Giebenrath das Leben „ein für allemal“ prägen. Allein der Widerstand gegen das diktatorische System der Kadettenanstalt ließ Hammerstein seinen anderen Weg finden. Ian McEwans „Lektionen“ nehmen durch erotische Verstörungen in der Erziehungsanstalt ihren Lauf auf. Nun gerät aber das aberwitzige Benediktiner-Internat in Hürlimans Roman in eine solche furiose Abfolge maßlos anarchistischer Explosionen, dass man angesichts der Eruptionen an Bildern, Porträts, schächtetiefer menschlicher Abgründe, himmelwärts gerichteter Obsessionen, dass man von Seite zu Seite aufs angespannteste blättert in der Erwartung der nächsten Koboldereien an Witz, Intellektualität, Bildkraft und literarischen Radschlägen. Arthur Goldau wird von seiner Mutter Mimi im Kloster abgegeben – allein dort hin zu gelangen braucht einen todernsten Slapstick – und kommt in eine zwar postchristliche, weil komplett verkalkte, aber keineswegs heidnische Welt, im Gegenteil: Menschen und Zeiten werden permanent durchschossen von einer ehemals totalen katholischen Welt. Man muss schon wie der Autor selbst ein solches Internat im Kloster als Lebenswelt kennengelernt haben (Hürlimann „absolvierte“ im exzellenten Kloster Einsiedeln seine Lebens-Schul-Zeit...), um diese geistlich-intellektuelle Grundausstattung zu erwerben und sie wieder abzustoßen. Die Detektivkomödie über die Suche nach dem roten Diamanten bietet nur die Bühne für einen schwindelerregenden Wirbel an irrealen Phantasieexzessen, der durchaus„Plausibilitätsfallen“ (Jochen Hieber, FAZ, 17.08.22) bereithält, bei so viel somnambuler Konstruktionsenergie kein Wunder. Der rote Diamant soll seinen Weg vom Hals der Cleopatra in den Kronschatz der Habsburger genommen haben – die Beschreibung der Stationen ist gewiss aufregender als das Juwel selbst. Jochen Hieber spricht in der FAZ nachdenklich-amüsiert von einer gewissen „Lachphilosophie“. Ich würde von einem überkochenden Literatur-Fondue sprechen, das bei jedem Spieß-Stich das köstlichste zu genießen verheißt. Womit wir wieder bei den Fest-Tagen sind und „Zwischen den Jahren“, einer Zeit, die gestaltet werden kann! Man kann sie zum Lesen nutzen, zum Gehen (Shane O'Mara „Vom Glück des Gehens, Was die Wissenschaft darüber weiß und warum es uns so gut tut“, Rowohlt Verlag 2021, 356 Seiten, 12.00 Euro) und zum Sehen – das hieße, vielleicht nach langer Pause wieder ins Museum!? Helmut Ruppel
317 Seiten
23 €

Kunst hoch drei
Augen für die Kunst. 50 Ansichten und Deutungen
Herausgegeben von Hans Dickel mit Beiträgen von Lorenz und Albrecht Wilkens, Liane Nelius,Marian Wild und Henry Thorau,
starfruit publication, 232 Seiten, 25 Euro
Michael Krüger. Über Gemälde von Giovanni Segantini
Schirmer/Mosel Verlag, 207 Seiten, 38 Euro
Kia Vahland. Ansichtssachen. Alte Bilder, neue Zeiten
Insel Verlag, 112 Seiten, 14 Euro
„ Es gab eine Zeit, da war die Malerei das Leitmedium … sie wandte sich in Kirchen an Analphabeten, im Audienzsaal an Botschafter und Könige, im Wohnzimmer an die Hausherrin. Wer einen Verstorbenen vermisste, ließ ihn malen, wer ein Gegenüber für sein Gebet suchte, erstand ein Andachtsbild … ein neuer Blick auf alte Meister zeigt: Ihre Themen sind unsere.“ So bündig, klar und knapp führt Kia Vahland, Kunstressort der Süddeutschen Zeitung, in ihr äußerst vergnügliches Bändchen ein. Mit 32 Bildinterpretationen zeigt sie auf unsere Themen in alten Bildern: Giorgones Venus trägt bei ihr die Überschrift: Schätzt Auszeiten ohne Pflichten. Tizians Noli me tangere wird von ihr geistvoll überschrieben mit: Was Menschen wirklich berührt. Rubens Venus frigida heißt bei ihr: Rubens zeigt, wie man würdevoll friert. Van Goghs Kurz vor seinem Tod betitelt sie: Van Gogh prangert Altersarmut an. Klimts Adele Bloch-Bauer überschreibt sie: Klimt kennt das richtige Verhältnis von Exzess und Kontrolle. Es ist durchgehend ein kluges Vergnügen, fordert zu eigenem Formulieren und damit Interpretieren auf, lässt sich festtäglichen Runden „spielen“ und ist ein geistvoller Schritt zu alten Bildern in neuen Zeiten. Ihr Inselbändchen „Gartenreich Wörlitz, Ausflug in eine Utopie“ (Inselbücherei 1499, 2022, 85 Seiten, 15 Euro) wird vom „Portal Kunstgeschichte“ hoch gelobt. Mit dem Bändchen in der Hand sollte man sich auf eine Reise nach Wörlitz einlassen.
Der große Vorteil, den der Band von Dickel, den Brüdern Wilkens und anderen hat, dass sie Bilder vor Augen führen, die wir in Berlin sehen können! Jacob van Ruisdaels „Eichen an einen See mit Wasserrosen“,Nicolas Poussins „Landschaft mit Matthäus und dem Engel“, Claude Lorrains „ Italienische Küstenlandschaft im Morgenlicht“, C.D. Friedrichs „Waldinneres bei Mondschein, John Constables „Das Dorf Higham am Fluss Stour“, Pierre Claeszens „Stilleben mit Römer und Silberschale“. Viele weitere Arbeiten führen, ähnlich wie bei Vahland, zu Interpretationen und leiten uns an, „Augen für die Kunst auszubilden“, eine intime Form der Selbsterkenntnis. Das Buch ist eine schöne Schatzkammer, in welche Richtung man seine Schritte auch lenkt. Die Überschriften der Interpretationen führen die Bildtitel sensibel weiter. Im Nachwort schreibt Lorenz Wilkens von einer freien, beweglichen „Anspannung der Aufmerksamkeit“ beim unmittelbaren Betrachten der Bilder. Doch auch im Buch wird sie sich wieder einstellen, gewiss beim Museumsbesuch mit dem Band in der Hand...
„Seit ziemlich genau fünfzig Jahren liebe ich das malerische Werk von Giovanni Segantini. In meiner Jugend hatte sein Bild Rückkehr in die Heimat von 1895 im Museum Dahlem mich auf seltsame Weise angezogen, so dass ich jahrelang behauptete, der Maler müsse (psychisch oder seelisch) etwa so gewickelt sein wie ich...“, eine berührende Eröffnung, ist doch von Liebe die Rede, von seltsamer Anziehung und von Geburt her währender Lebensnähe („gewickelt sein“). So eröffnet Michael Krüger seine mit Segantini verbundene Lebens-und Liebesgeschichte. Der recht bemessene Abstand verbindet am besten, diese kluge Regel fürs Zusammenleben, fürs Leben mit Bildern und Büchern (wie ist es mit der Musik?) wird jede Kunsthistorikerin und jeder Bildbetrachter beherzigen. Krüger ist keiner – er „liebt“, mehr noch, er nimmt, wie aufgeklärt oder analytisch auch immer, eine tiefe Verwandtschaft, eine gegebene Verbundenheit mit dem Maler wahr. Die Zunft reagiert auf das Buch verwundert, mal grämlich dämpfend, mal verwundert-beglückt. Roman Bucheli mag den Nerven des Buches (Neuen Zürcher Zeitung,02.07.'22) am nahesten kommen: Er sieht, in der Sprache der Romantik, eine „Seelenverwandtschaft“ der beiden in ihrer Liebe zum unverstellten Licht der Schöpfung, in den Anflügen zu einer elementaren Kunstreligion, zum Existieren in einem himmelsgleichen Lichtraum fernab aller trubeligen Ablenkungen des geschäftig-leeren Alltags. Das würde Segantini, den Maler des Lichtes über der Oberengadiner Alpenwelt, der nur „draußen“, plein air, arbeitete und somit allzeit in der elementaren bäuerlichen Welt lebte mit dem auch aus der land-wirtschaftlichen Erfahrung stammenden, und jüngst in erzwungenen Einsamkeiten ausharrenden Krüger eng verbinden. Bucheli geht so weit, beiden eine gewisse religiöse Zuneigung zur lichterfüllten Schönheit der Schöpfung, dem Schau-Raum Gottes, zuzusprechen. Und wenn Krüger sagt: „Mit Segantini kann man sehr weit sehen“, ist das gefüllt mit wortlosen Ahnungen und Empfindungen und wir verstehen: Der Romanautor ist ein Romantiker.
Michael Krüger nähert sich seinem Maler literarisch, sprachlich mit-malend, empathisch; er neigt sich zu den Bildern, in unverstellter Zuneigung und Zuwendung. Er widmet den schweren, schönen bilderreichen Band den Freunden, „mit denen ich oft vor den Bildern gestanden habe“ und die „während des Schreiben meines Textes gestorben“ sind - unter ihnen Karl Heinz Bohrer und Klaus Wagenbach. Und ein klein wenig klingt durch das Buch der Versuch, sich mit den Bildern Segantinis noch einmal des eigenen Lebens zu vergewissern. Da schreibt einer ein Buch für sich und es wird ein Geschenk für viele..
Helmut Ruppel

Shelly Kupferberg. Isidor, Ein jüdisches Leben
Diogenes Verlag
„Mein Urgroßonkel war ein Dandy. Sein Name war Isidor. Oder Innozenz. Oder Ignaz. Eigentlich aber hieß er Israel...er war eigensinnig und voller Stolz...wie sonst hätte er sich aus Lokutni bei Tłumacz, Tłumacz bei Kolomea, Kolomea bei Lemberg ganz nach oben hangeln können? Bis zu dem Tag, als Menschen ausgelöscht werden sollten...“ Menschen mit Eigensinn begegnet man häufig in heutigen Büchern – weil sie seltener werden? Shelly Kupferberg, in Berlin lebhaft engagiert in der medial-kulturellen Öffentlichkeit, hat den weisen Satz der jüdischen Tradition „Die Kette der Generationen darf nicht reißen“ wahr gemacht und ist in die Familiengeschichte eingedrungen, mit liebevoller, auch vorm Schrecken nicht kapitulierenden Detektivinnenarbeit. Die führt sie nach Tel Aviv (zum Hängeboden in der großelterlichen Wohnung, wo die Kartons mit alten Briefen liegen...) und nach Wien in diverse Archive mit verwunderlichen Quellen, die bringt sie zu Studien und biographischen Rekonstruktionen im Geäst der verzweigten Familie. Eine wichtige Rolle nimmt auch ihr Großvater, der Historiker Walter Grab, ein. An dieser Stelle musste ich die Lektüre abbrechen, denn ich habe Walter Grab in einem langen Gespräch kennengelernt und wusste damals nichts von seiner Geschichte. Unser Gespräch ging um „frühe Demokraten“, sein Spezialgebiet. Ich erinnere mich, dass er in Nikolaus Lenaus Gedichten politische Spuren witterte, was mir völlig neu war. Nach einer gehörigen Scham-Pause las ich weiter...
Shelly Kupferberg liest gegenwärtig an vielen Orten, gibt auskunftsreich Interviews und hat mit ihrem Band einen unvergleichlichen weiteren Baustein zu ihrem Untertitel hinzugefügt: „Ein jüdisches Leben.“ Wie so oft erzählt ein Witz auf mehreren Ebenen mehr als viele Erzählungen vom Durchkommen. Einer aus der Freundschaft Isidors macht sich auf den Weg aus der Sowjetunion nach Amerika:und der Grenzbeamte fragt ihn, was das für eine Büste sei, die er mit sich trage. Darauf korrigiert ihn der Jude: „Nicht was ist das, sondern wer ist das? Lenin!“ Der Grenzbeamte ist entzückt und beeindruckt von so viel politischem Rückgrat und wünscht dem Juden viel Glück im Exil. Als dieser in die USA einreist und auch dort vom Zollbeamten befragt wird, wer denn das sei, den diese Büste darstelle, korrigiert der Jude: „Nicht wer das ist, sondern::Was ist das? Sei die richtige Frage, und die Antwort dazu laute: Platin!“
Shelly Kupferberg erzählt Geschichte in Geschichten. Am Ende besucht sie Isidors Grab auf dem Wiener Zentralfriedhof und sieht dort Rehe und Hasen, die drumherum grasen. Und ist entzückt, bis sie erfährt, dass Jäger sie auch erlegen; ein Bild für die Gebrochenheit dieser Welt. Unbedingt sehen, unbedingt lesen! Helmut Ruppel
240 Seiten
24 €

Emine Sevgi Özdamar, Ein von Schatten begrenzter Raum
Suhrkamp Verlag
Es gibt in der Buchbranche den Begriff longseller, so z.B. für H.M. Enzensbergers klug-vergnügliches Buch über die Mathematik; für books, which take a long time to read gibt es noch keinen Fachbegriff. Sie entziehen sich der Etikettierung. Es ist schier unmöglich, Emine Sevgi Özdamar zu etikettieren, weil ihre Arbeiten, ihr Schreiben, ihr Erzählen im wörtlichen Sinne un-be-schreiblich sind, „als würde sie die Welt ein- und ausatmen“, sagte die Laudatorin Marie Schmidt bei der Büchnerpreis-Verleihung mit vollem Recht, und auch dieser Satz ist völlig hilflos und unzureichend angesichts der Sprache Özdamars, zu der man sich verhalten muss wie zu einem Lebewesen,der Wetterlage oder einem Tsunami. Ihr Buch ist einer Bühne gleich, ohne Ende in alle Himmelsrichtungen, erfüllt von hundert Sprachen – hundert? Wenn die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung ihre „neue poetische Weite“ des Geistes und der Großherzigkeit preist, bleibt das noch immer auf der Ebene einer Sprachlähmung. Ich gebe es daher auf – Özdamars Buch ist nur mit einem Satz von ihr selber zu rühmen: „Ich wollte nicht mehr schlafen, weil man beim Schlafen so viel Zeit verliert.“ Sie kommt Anfang der Siebziger Jahre aus Istanbul nach Deutschland, verfällt dem deutschen Theater und seinen Regisseuren, rettungslos Benno Besson und nun „spielt“ ihr Leben zwischen Berlin, Bochum, Paris und dem Rest der Welt... Ein kluger Mann nennt sie „Poetin des Unsagbaren“. So ist es. Helmut Ruppel
765 Seiten
28 €

Die Buchhandlung
an der FU Berlin
Königin-Luise-Straße 41
14195 Berlin
Telefon 030-841 902-0
Telefax 030-841 902-13
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 10 - 18.30 Uhr
Samstag: 10 - 16 Uhr
Adventsamstage: 10 - 18.30 Uhr
Shop: 24 Stunden täglich
Datenschutz bei Schleichers
Schleichers bei Facebook
Schleichers bei Instagram
✉ Kartenbestellung / Signiertes Buch reservieren
✉ Newsletter abonnieren